Farbmanagement-Grundlagen
Farbräume und Farbsysteme
Es gibt eine große Menge von Farben, die wir Menschen sehen können.
Daneben gibt es auch Farben, die zwar von manchen Tieren gesehen werden
können, aber nicht von uns Menschen; solche Farben bleiben im
ICC-Farbmanagement unberücksichtigt, denn es ist ein System für Menschen.
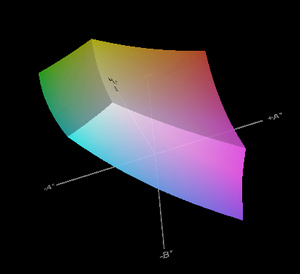 Um eine bestimmte Menge an Farben grafisch
darzustellen, hat sich eine dreidimensionale Darstellung eingebürgert:
Zwei Achsen definieren dabei den Farbton und die dritte Achse definiert
die Helligkeit. Angelehnt an diese räumliche Darstellung spricht man von
Farbräumen.
Um eine bestimmte Menge an Farben grafisch
darzustellen, hat sich eine dreidimensionale Darstellung eingebürgert:
Zwei Achsen definieren dabei den Farbton und die dritte Achse definiert
die Helligkeit. Angelehnt an diese räumliche Darstellung spricht man von
Farbräumen.
Ein Farbraum ist also kein tatsächlicher Raum, sondern ein reines
Gedankenmodell. Erst durch die drei Dimensionen können wir Farb- und
Helligkeitswerte anschaulich in Bezug setzen.
An den Außenseiten des Farbraumes finden sich die stark gesättigten
Farben. In der Mittelachse liegen die farblosen Grautöne; daher spricht
man auch von der Grauachse. Ein Ende der Grauachse ist der Schwarzpunkt,
das entgegengesetzte Ende der Weißpunkt.
Im Farbmanagement ist die Sättigung entscheidend; daher
genügt es zum Vergleich von Farbräumen häufig, einen zweidimensionalen
Schnitt des Farbraumes zu zeigen. Hierfür wählt man die mittlere
Helligkeit, oder man projiziert die maximal auftretenden Sättigungen auf
eine Fläche.
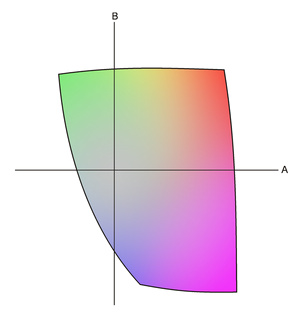 Jeder Farbraum wird definiert von seinen
Grenzen; sie repräsentieren die höchstmögliche Farbsättigung in der
jeweiligen Richtung. Liegen diese Grenzen weit auseinander, spricht man
von einem großen Farbraum. Liegen sie eng beisammen, hat man es mit einem
kleinen Farbraum zu tun. Die Farbraum-Größe bezeichnet man im Englischen
als "Gamut"; dieser Begriff fällt im Zusammenhang mit Farbmanagement sehr
oft.
Jeder Farbraum wird definiert von seinen
Grenzen; sie repräsentieren die höchstmögliche Farbsättigung in der
jeweiligen Richtung. Liegen diese Grenzen weit auseinander, spricht man
von einem großen Farbraum. Liegen sie eng beisammen, hat man es mit einem
kleinen Farbraum zu tun. Die Farbraum-Größe bezeichnet man im Englischen
als "Gamut"; dieser Begriff fällt im Zusammenhang mit Farbmanagement sehr
oft.
Der größte definierte Farbraum (also der Farbraum mit dem maximalen
Gamut) ist der CIE-Lab-Farbraum, der als Referenzfarbraum (englisch
"Profile Connection Space", kurz PCS) definiert ist. Er ist so
dimensioniert, dass er mehr oder weniger alle Farben enthält, die ein
normaler Mensch sehen kann. Jeder andere im Farbmanagement verwendete
Farbraum stellt eine Teilmenge von CIE-Lab dar.
(Streng genommen heißt dieser Referenzfarbraum CIE-L*a*b*; mit den
Sternchen unterscheiden ihn die Fachleute von einer älteren
Lab-Definition.
Zudem gibt es neben CIE-Lab noch einen anders definierten, aber gleich
großen Referenzfarbraum namens CIE-XYZ.
Also wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie irgendwo CIE-L*a*b* oder
CIE-XYZ lesen. Der Einfachheit halber spreche ich in dieser Artikel-Serie
ab jetzt immer von CIE-Lab, wenn es um einen der Referenzfarbräume geht.)
Dank des physikalisch genau definierten Referenzfarbraumes CIE-Lab gibt
es ein Bezugssystem, mit dem das Farbmanagement rechnen kann. Jeder Farbe,
die in irgendeinem (Teil-)Farbraum vorkommt, kann man einen exakten Wert
in CIE-Lab zuordnen. So kann man Farben umrechnen, die in verschiedenen
Farbräumen verschiedene Werte annehmen. Das ist die Grundlage des
praktischen Farbmanagements.
Farbsysteme
Da man als Digitalfotograf hauptsächlich mit dem RGB-Farbsystem zu tun
hat, ist der Umgang mit anderen Systemen anfangs etwas ungewohnt.
Die gute Nachricht dabei: Für 99 % aller Anwendungen, mit denen man als
Hobbyfotograf zu tun hat, kann man das gewohnte RGB-System nutzen. Die
Kenntnis anderer Systeme ist lediglich hilfreich zum Verständnis der
Theorie.
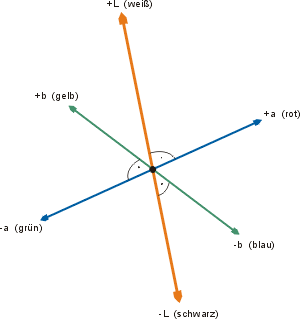 Im Lab-Farbsystem ist
insbesondere der Referenzfarbraum CIE-Lab definiert. Es arbeitet mit drei
Werten, die jeweils von 0 bis 100 % betragen können: der Helligkeit L und
den zwei Farbwerten a und b. Der Farbwert a befindet sich auf einer Skala
zwischen Grün und Rot/Magenta, der Farbwert b auf einer Skala zwischen
Blau und Gelb/Orange.
Im Lab-Farbsystem ist
insbesondere der Referenzfarbraum CIE-Lab definiert. Es arbeitet mit drei
Werten, die jeweils von 0 bis 100 % betragen können: der Helligkeit L und
den zwei Farbwerten a und b. Der Farbwert a befindet sich auf einer Skala
zwischen Grün und Rot/Magenta, der Farbwert b auf einer Skala zwischen
Blau und Gelb/Orange.
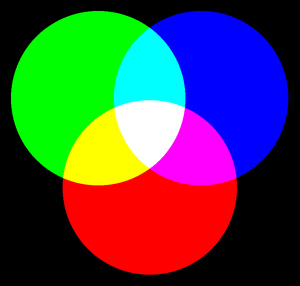 Im RGB-Farbsystem
werden Farben und Helligkeit aus den additiven Grundfarben Rot, Grün und
Blau zusammengesetzt, wobei jede Farbe einen Wert von 0 bis 255 annehmen
kann. Überlagern sich Rot, Grün und Blau mit jeweils dem Maximalwert 255,
addieren sie sich zu Weiß; daher spricht man von einem additiven System.
Im RGB-Farbsystem
werden Farben und Helligkeit aus den additiven Grundfarben Rot, Grün und
Blau zusammengesetzt, wobei jede Farbe einen Wert von 0 bis 255 annehmen
kann. Überlagern sich Rot, Grün und Blau mit jeweils dem Maximalwert 255,
addieren sie sich zu Weiß; daher spricht man von einem additiven System.
Anders als in Lab ist in RGB keine eindeutige Trennung nach Helligkeits-
und Farbinformation gegeben; wer nur das RGB-Farbmodell kennt, tut sich
daher mit dem Verständnis des grundlegenden Farbmanagements etwas schwer.
RGB ist der natürliche Farbraum jedes Monitors und der meisten
Digitalkameras, denn dort werden Farben genau aus Rot, Grün und Blau
gemischt. Auch Fotobelichter arbeiten in RGB.
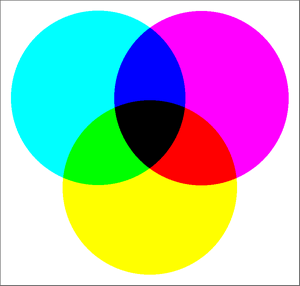 Das CMYK-Farbsystem
wird hauptsächlich benutzt, um Mischfarben für den Offsetdruck (also
professionellen Druck in hohen Auflagen) zu bekommen. Die Buchstaben CMYK
stehen für die englischen Bezeichnungen der subtraktiven Grundfarben Cyan
(Türkis), Magenta (Purpur) und Yellow (Gelb) sowie die sogenannte
Key-Farbe (Schwarz).
Das CMYK-Farbsystem
wird hauptsächlich benutzt, um Mischfarben für den Offsetdruck (also
professionellen Druck in hohen Auflagen) zu bekommen. Die Buchstaben CMYK
stehen für die englischen Bezeichnungen der subtraktiven Grundfarben Cyan
(Türkis), Magenta (Purpur) und Yellow (Gelb) sowie die sogenannte
Key-Farbe (Schwarz).
Subtraktive Farbmischung ist das Prinzip, das wir z. B. vom Mischen von
Wasserfarben kennen. Jede Farbe kann einen Wert von 0 bis 100 % annehmen.
Cyan, Magenta und Yellow zu jeweils 100 % übereinander gedruckt sollten
theoretisch Schwarz ergeben, aber da das in der Praxis des Offsetdrucks
nie so perfekt klappt (es entsteht nur ein schmutziges Dunkelgrau), druckt
man die ganz dunklen Stellen zusätzlich noch mit schwarzer Farbe.
Als Hobbyfotograf und selbst als Zeitungsfotograf wird man eher selten in
die Situation kommen, zu druckende Bilder nach CMYK konvertieren zu müssen
(siehe hier). Normalerweise gibt der
Fotograf RGB-Bilder ab und überlässt die Konvertierung dem Verlag bzw. der
Druckerei.
Obwohl auch Tintenstrahldrucker und Farblaserdrucker ihre Farben mit
einer Form von CMYK mischen, kommt der Benutzer damit ebenfalls nicht in
Berührung; in diesem Fall erfolgt die Konvertierung automatisch im
Druckertreiber, und der Benutzer arbeitet immer mit RGB. Das ist auch
besser so, da jeder Drucker sein eigenes Farbmischverfahren anwendet, das
nicht mit einem der standardisierten CMYK-Offset-Farbräume übereinstimmt;
man denke zur Verdeutlichung an Tintenstrahldrucker mit sechs oder acht
Tinten.
Autor: Andreas Beitinger
Letzte Änderung: Oktober 2017
IMPRESSUM
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
 Nächster
Teil
Nächster
Teil
 Zurück
zur Übersicht
Zurück
zur Übersicht

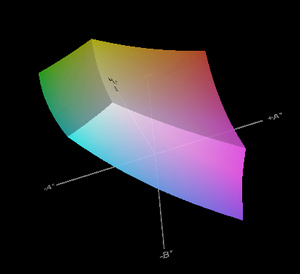 Um eine bestimmte Menge an Farben grafisch
darzustellen, hat sich eine dreidimensionale Darstellung eingebürgert:
Zwei Achsen definieren dabei den Farbton und die dritte Achse definiert
die Helligkeit. Angelehnt an diese räumliche Darstellung spricht man von
Farbräumen.
Um eine bestimmte Menge an Farben grafisch
darzustellen, hat sich eine dreidimensionale Darstellung eingebürgert:
Zwei Achsen definieren dabei den Farbton und die dritte Achse definiert
die Helligkeit. Angelehnt an diese räumliche Darstellung spricht man von
Farbräumen.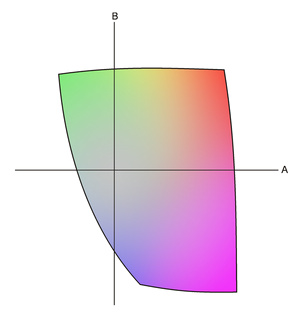 Jeder Farbraum wird definiert von seinen
Grenzen; sie repräsentieren die höchstmögliche Farbsättigung in der
jeweiligen Richtung. Liegen diese Grenzen weit auseinander, spricht man
von einem großen Farbraum. Liegen sie eng beisammen, hat man es mit einem
kleinen Farbraum zu tun. Die Farbraum-Größe bezeichnet man im Englischen
als "Gamut"; dieser Begriff fällt im Zusammenhang mit Farbmanagement sehr
oft.
Jeder Farbraum wird definiert von seinen
Grenzen; sie repräsentieren die höchstmögliche Farbsättigung in der
jeweiligen Richtung. Liegen diese Grenzen weit auseinander, spricht man
von einem großen Farbraum. Liegen sie eng beisammen, hat man es mit einem
kleinen Farbraum zu tun. Die Farbraum-Größe bezeichnet man im Englischen
als "Gamut"; dieser Begriff fällt im Zusammenhang mit Farbmanagement sehr
oft.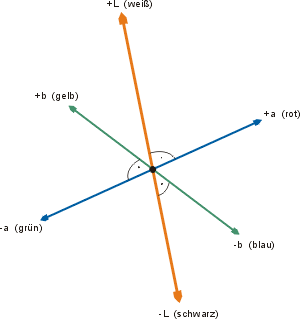 Im Lab-Farbsystem ist
insbesondere der Referenzfarbraum CIE-Lab definiert. Es arbeitet mit drei
Werten, die jeweils von 0 bis 100 % betragen können: der Helligkeit L und
den zwei Farbwerten a und b. Der Farbwert a befindet sich auf einer Skala
zwischen Grün und Rot/Magenta, der Farbwert b auf einer Skala zwischen
Blau und Gelb/Orange.
Im Lab-Farbsystem ist
insbesondere der Referenzfarbraum CIE-Lab definiert. Es arbeitet mit drei
Werten, die jeweils von 0 bis 100 % betragen können: der Helligkeit L und
den zwei Farbwerten a und b. Der Farbwert a befindet sich auf einer Skala
zwischen Grün und Rot/Magenta, der Farbwert b auf einer Skala zwischen
Blau und Gelb/Orange.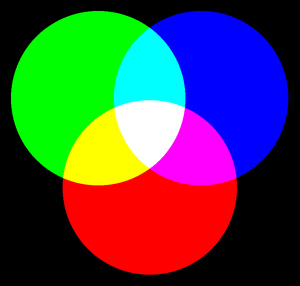 Im RGB-Farbsystem
werden Farben und Helligkeit aus den additiven Grundfarben Rot, Grün und
Blau zusammengesetzt, wobei jede Farbe einen Wert von 0 bis 255 annehmen
kann. Überlagern sich Rot, Grün und Blau mit jeweils dem Maximalwert 255,
addieren sie sich zu Weiß; daher spricht man von einem additiven System.
Im RGB-Farbsystem
werden Farben und Helligkeit aus den additiven Grundfarben Rot, Grün und
Blau zusammengesetzt, wobei jede Farbe einen Wert von 0 bis 255 annehmen
kann. Überlagern sich Rot, Grün und Blau mit jeweils dem Maximalwert 255,
addieren sie sich zu Weiß; daher spricht man von einem additiven System.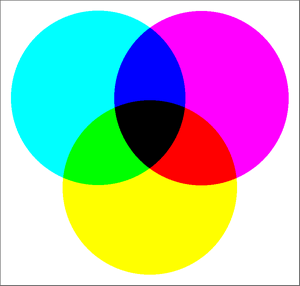 Das CMYK-Farbsystem
wird hauptsächlich benutzt, um Mischfarben für den Offsetdruck (also
professionellen Druck in hohen Auflagen) zu bekommen. Die Buchstaben CMYK
stehen für die englischen Bezeichnungen der subtraktiven Grundfarben Cyan
(Türkis), Magenta (Purpur) und Yellow (Gelb) sowie die sogenannte
Key-Farbe (Schwarz).
Das CMYK-Farbsystem
wird hauptsächlich benutzt, um Mischfarben für den Offsetdruck (also
professionellen Druck in hohen Auflagen) zu bekommen. Die Buchstaben CMYK
stehen für die englischen Bezeichnungen der subtraktiven Grundfarben Cyan
(Türkis), Magenta (Purpur) und Yellow (Gelb) sowie die sogenannte
Key-Farbe (Schwarz).